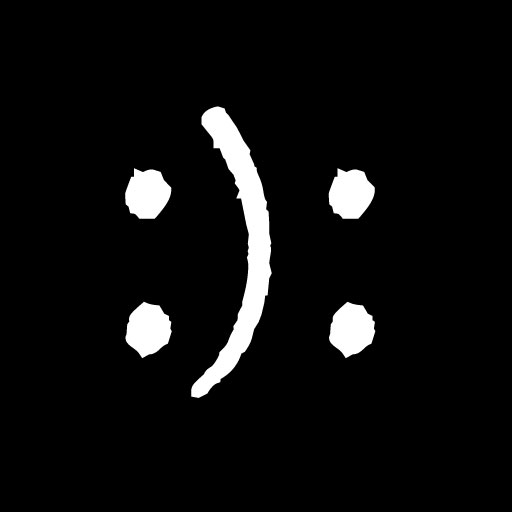Trophäen, Tarnegoismus und die Mär von der Regulierung
Es gibt kaum ein Wort, das so nach Verantwortung klingt und doch so sehr nach Blut riecht wie Bestandsregulierung. Ein Begriff, geboren aus der moralischen Notwehr des Täters, um die Scham vor sich selbst zu betäuben. Denn nichts klingt edler, als wenn der Mörder behauptet, er habe nur aufgeräumt.
Man nennt es „Hege“ – als wäre Töten ein Akt der Fürsorge. Man nennt es „Naturschutz“ – als ob das Schießen auf ein Reh den Wald gesünder machte. In Wahrheit ist es ein religiöser Akt der menschlichen Überheblichkeit: Der Mensch stilisiert sich zum Gott, der Leben zuteilt und entzieht, als gehöre ihm das Recht über alles, was atmet.
Die Begründung ist immer die gleiche: „Ohne Jäger gäbe es zu viele Tiere.“ Das klingt fast rührend, wenn man vergisst, dass dieselben Jäger dafür gesorgt haben, dass es keine Wölfe, keine Luchse, keine Bären mehr gibt – die eigentlichen Regulatoren eines funktionierenden Ökosystems. Man tötet die natürlichen Feinde und übernimmt dann deren Rolle – schlechter, brutaler und mit weniger Verständnis für das, was Balance bedeutet.
Die Natur reguliert sich selbst. Sie tat es Jahrmillionen, bevor der Mensch auf die Idee kam, sie managen zu müssen. Doch der moderne Jäger sieht in der Wildbahn nicht ein Netz aus Leben, sondern ein Schießstand. Er trägt seine Tarnjacke wie eine Uniform der Zivilisation und glaubt, Ordnung zu schaffen, während er Chaos hinterlässt.
Man spricht von „passionierten Jägern“. Leidenschaft als Tarnung für Blutdurst. Leidenschaft für den Moment, in dem Macht sich entlädt – der Blick durchs Zielfernrohr, der Herzschlag vor dem Schuss, die Erregung über das Leid. Und dann dieses makabre Ritual: ein toter Körper, der stolz posiert wird, als wäre er eine Trophäe menschlicher Überlegenheit. Es ist Pornografie des Todes, abgelichtet in Hochglanz.
Trophäenjäger sind die Touristen der Zerstörung. Sie reisen in Länder, deren Tiere sie nur aus Dokumentationen kennen, um dort etwas zu töten, das sie nie verstanden haben. Und wenn einer von ihnen von einem Büffel aufgespießt wird, nennt man es „tragischen Unfall“. Nein. Das ist keine Tragödie. Das ist die Rückkehr der Physik, die Antwort der Natur auf Jahrhunderte der Arroganz. Wer das Gleichgewicht stört, wird Teil davon.

Und wer glaubt, dass die Natur ohne den Menschen aus dem Gleichgewicht gerät, sollte einmal die Stille eines Waldes hören, den niemand bewirtschaftet. Dort regelt sich alles, weil niemand eingreift. Tod und Geburt, Fressen und Gefressenwerden – kein Drama, kein Triumph, nur Kreislauf. Der Mensch dagegen tötet selektiv, planlos, oft aus Lust. Er löscht Leben, weil er es kann – und nennt das Zivilisation.
Die Jagd ist kein Sport, kein Handwerk, kein Erbe – sie ist das Überbleibsel eines patriarchalen Götterkomplexes, der das Recht auf Leben nach dem Kaliber bemisst. Und wer dabei „Leidenschaft“ empfindet, sollte sich fragen, ob seine Seele noch im gleichen Jahrhundert wohnt wie sein Körper.
Das ist das Paradoxon unserer Zeit: Die Spezies, die das meiste zerstört, hält sich für die Bewahrerin.
Vielleicht ist es das, was am meisten schmerzt: dass man für Empathie keine Kugeln braucht, aber für die Rechtfertigung des Tötens ganze Waffenschränke voller Argumente.
Manchmal denke ich, der Wald müsste das Schweigen brechen. Bäume sollten schreien, wenn Blut in ihren Wurzeln versickert. Vielleicht würde man dann verstehen, was für ein Wahnsinn das ist.